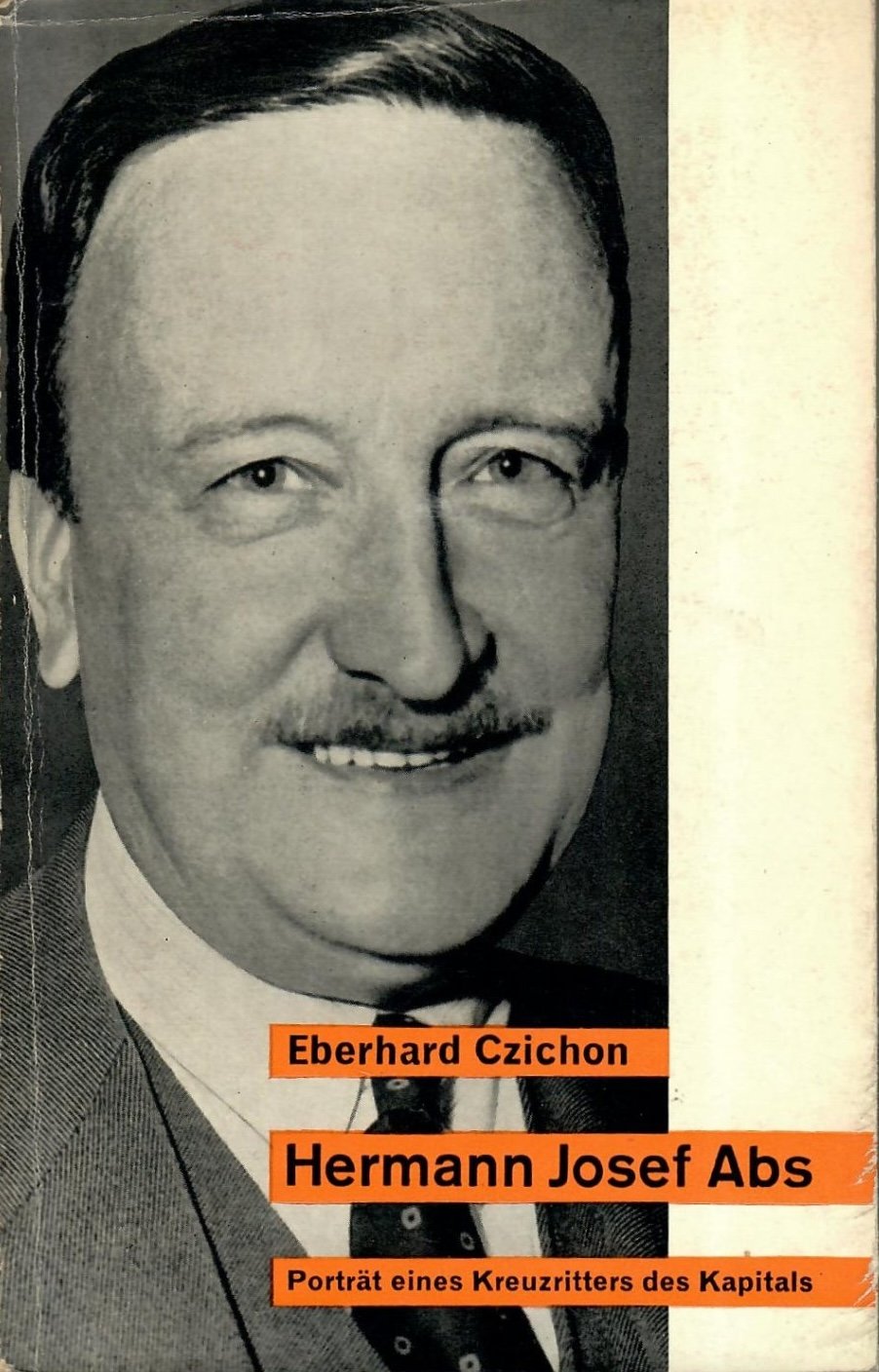Kundenkartei, Bürobetrieb Wäschefabrik Winkel; Foto: Tim Schanetzky, 2004.
Glossar der Kapitalismuskritik
DDR-Westpropaganda: der Fall Hermann Josef Abs
von Luis Antonio Teixeira
Der Beginn der deutschen Zweistaatlichkeit ging in der DDR mit schwerwiegenden ökonomischen Krisen und einer daraus resultierenden Fluchtbewegung einher: Bis zum Sommer 1961 hatten fast vier Millionen DDR-Bürger – viele von ihnen jung und gut ausgebildet – „mit den Füßen abgestimmt“ und waren in den Westen geflohen. Am 13. August 1961 schloss die Berliner Mauer die letzte Lücke im Eisernen Vorhang. Zugleich war aber umso deutlicher geworden, wie gering die Akzeptanz des Sozialismus in der DDR war – was das eigentliche Ziel der SED, nämlich das eigene Gesellschaftsmodell auf ganz Deutschland zu übertragen, in Frage stellte. Umso wichtiger wurde jetzt die Westpropaganda, die sich in einer Art „Sündenbockoffensive“ gegen die westdeutschen Eliten richtete. Im „Braunbuch“ von 1965 und in vielen weiteren Broschüren gab die DDR meist zutreffende Informationen über die NS-Vergangenheit des westdeutschen Führungspersonals in Politik, Justiz und Wirtschaft heraus. Sie verfolgte damit das Ziel, die „Bundesrepublik pauschal in die Tradition des Dritten Reiches zu stellen“ (Schanetzky, 2004, S. 102). Entsprechende Kampagnen richteten sich etwa gegen Theodor Oberländer (Bundesvertriebenenminister im Kabinett Adenauer II), dem man im Kontext eines Schauprozesses 1960 vorwarf, „im Sommer 1941 an der Erschießung mehrerer tausend Juden und Polen“ beteiligt und „für den Tod zahlreicher Menschen im Kaukasus verantwortlich“ gewesen zu sein (Arnold, 2002, S. 453). Oberländer trat zurück. Wiederholt geriet Adenauers Kanzleramtsstaatssekretär Hans Globke ins Visier, weil er an einem juristischen Kommentar über die Nürnberger Rassegesetze beteiligt gewesen war. Schon beim Jerusalemer Eichmann-Prozess versuchte der Jurist Friedrich Karl Kaul, den Fokus vor allem auf Globke zu richten; im Juli 1963 folgte ein Schauprozess in Ost-Berlin, in dem der abwesende Globke zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Im Jahr darauf begann eine Kampagne gegen den Bundespräsidenten Heinrich Lübke, welcher auf Basis teils gefälschter Dokumente als „KZ-Baumeister“ bezeichnet wurde (vgl. Wentker, 2023, S. 82). Neben Spitzenpolitikern geriet zugleich die westdeutsche Großindustrie in den Fokus. Den Frankfurter Auschwitz-Prozess versuchte Friedrich Karl Kaul zu einer Art Schauprozess gegen die frühere I.G. Farbenindustrie AG und ihre Nachfolgeunternehmen Bayer, Hoechst und BASF umzufunktionieren (Brünger, 2017, S. 152). Kaul sah es als Teilerfolg, dass der frühere Farben-Manager Heinrich Bütefisch sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben musste (Brünger, 2017, S. 153).
Erschien 1969 im Ost-Berliner Union-Verlag kurz vor dem hundertjährigen Jubiläum der Deutschen Bank: Eberhard Czichons Kampfschrift über den Bankier Hermann Josef Abs.
Hermann Josef Abs vs. Eberhard Czichon
Es war also kein Zufall, dass 1969 schließlich auch Hermann J. Abs ins Visier der DDR-Westpropaganda geriet. Obgleich der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank nie Mitglied der NSDAP gewesen war, ist das genaue Ausmaß seiner Beteiligung an den Verbrechen des Nationalsozialismus auch heute noch Gegenstand einer Forschungskontroverse. Der Umstand, dass Abs bereits in den fünfziger Jahren wieder in die Führungsriege der Deutschen Bank zurückkehrte und seit den Londoner Verhandlungen über die deutsche Auslandsverschuldung als Vertrauter Adenauers galt, machte ihn erst recht zum Symbol einer ungebrochenen Kontinuität zwischen NS-Staat und Bundesrepublik. Ihr eigentlicher Kern, so die Lesart im Osten, lag im kapitalistischen Wirtschaftssystem. Über die Erwähnung im „Braunbuch“ war Abs zwar noch hinweggegangen; die Publikationen Eberhard Czichons rund um das 100-jährige Jubiläum der Deutschen Bank ließen sich aber nicht mehr so leicht vom Tisch wischen.
Der 1930 geborene Czichon war ursprünglich Großhandelskaufmann und erst spät zum Geschichtsstudium gelangt. Seine Bekanntschaft mit Paul Neuhöffer, dem Eigentümer des in Köln ansässigen, aber maßgeblich von der SED finanzierten Pahl-Rugenstein Verlages, ermöglichte ihm die Veröffentlichung von Vorarbeiten seiner Dissertation. Schon darin bezichtigte Czichon Banken, Industrielle und Unternehmer, Hitler aus reinem Profitinteresse zur Macht verholfen zu haben. Neuhöffer bat Czichon anschließend darum, seine Nachforschungen in Bezug auf Abs zu erweitern. Czichon profitierte dabei von der Tatsache, dass das Archiv der Deutschen Bank bei Kriegsende in Ost-Berlin zurückgelassen worden war: Czichon hatte, ironischerweise im Gegensatz zur Deutschen Bank, Zugriff auf die alten Akten und Dokumente.
Pünktlich zum 1970 anstehenden Jubiläum der Deutschen Bank brachte Czichon zunächst die Ostausgabe seines Buches unter dem Titel Hermann Josef Abs. Porträt eines Kreuzritters des Kapitals und bald darauf auch die Westausgabe bei Pahl-Rugenstein in Köln unter dem Titel Der Bankier und die Macht heraus. Czichon warf Abs vor, er habe „die Kriegsziele einer Neuordnung ‚Groß-Europas‘ maßgeblich mitformuliert“ und „das Expansionsprogramm auch selbst umgesetzt“ (Brünger, 2017, S. 166): „Ilgner und Abs kamen im beiderseitigen Interesse darin überein, in Wien ein starkes Bankinstitut zu schaffen, das von Berlin aus geleitet, als selbstständige Institution die Wirtschaftsexpansion in Südeuropa finanziell absichern könne und der Gruppe IG-Farben/Deutsche Bank auch in diesem Raum die Priorität vor der Dresdner Bank und der mit ihr liierten Monopolen [sic!] sichern sollte.“ (Czichon, 1970, S. 101). Des Weiteren formulierte Czichon den Vorwurf, Abs habe sich an „Arisierungen“ beteiligt und daran auch persönlich bereichert: „Im Vorstand der Deutschen Bank gelang es Hermann Josef Abs, seine [...] ‚Arisierungs‘-Erfahrung bei dieser Aktion so raffiniert anzuwenden, daß er sowohl das Ziel der Enteignung des jüdischen Eigentums erreichte, als auch gleichzeitig Devisen für die faschistische Kriegsvorbereitung gewann“ (Czichon, 1970, S. 90). Abs‘ Nachkriegskarriere interpretierte Czichon als Nachweis dafür, dass die Eingriffe der Westalliierten in die Wirtschaft halbherzig gewesen seien. So verkörperte Abs „wie kaum ein anderer Wirtschaftsmanager die Kontinuität des Machtstrebens des deutschen Imperialismus“, obwohl er von den Alliierten auf die Liste der „ökonomischen Kriegsverbrecher“ gesetzt worden war (Czichon, 1970, S. 230, 146). Diese Anklagen standen fest auf dem Fundament der Komintern-Definition von 1935, wonach der Faschismus als die „offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten und imperialistischsten Elemente des Finanzkapitals“ zu gelten hatte.
Während die Deutsche Bank zum Jubiläum eine Festschrift herausbrachte, schuf schließlich eine Marburger Studentin den eigentlichen Anlass für die Eskalation des Konflikts. Sie kündigte im Frühjahr 1970 ihr Konto bei der Deutschen Bank und begründete dies mit ihrer Czichon-Lektüre. Der Marburger Filialleiter nannte das Buch in seiner Antwort „in allen wesentlichen Punkten sachlich unwahr und beleidigend“ (zit. n. Brünger, 2017, S. 172), was wiederum den DDR-Juristen Friedrich Karl Kaul auf den Plan rief. Gemeinsam mit Czichon forderte er die Deutsche Bank auf, die Anschuldigungen fallen zu lassen und einen „Bußbetrag“ von 5.000 Mark zu zahlen. Andernfalls werde man eine Verleumdungsklage einreichen. Stattdessen zog die Deutsche Bank vor das Stuttgarter Landgericht. In ihrer Klageschrift bezichtigte sie Czichon der „Verleumdung und üble[n] Nachrede“; hinter seiner Publikation stehe die Tendenz, den Kapitalismus zu verteufeln. Wichtige Aussagen der „politischen Tendenzschrift“ seien unwahr oder könnten nicht den „Anspruch auf Wissenschaftlichkeit“ erheben (Brünger, 2017, S. 172-175).
Obwohl innerhalb der SED-Führung nicht unumstritten, zielte die Kampagne darauf, sich in die westdeutsche Diskussion über die Macht der Großbanken einzuschalten und zugleich das nächste Mitglied der westdeutschen Eliten öffentlich zur Schau zu stellen. Allerdings ging dieser Plan nicht auf, weil die Deutsche Bank als Sieger aus dem Prozess hervorging: Journalisten und Wissenschaftler halfen Abs dabei, in der westdeutschen Medienöffentlichkeit vor allem den Tenor der Klageschrift zu verbreiten. Sachliche Fehler in Czichons Buch trugen dazu besonders bei. So gelangte auch das Ministerium für Staatssicherheit zu der Erkenntnis, dass Czichons „oberflächliche Arbeitsweise und Leichtfertigkeit“ an wichtigen Punkten des Buches zu „offensichtlich falschen und unbewiesenen Behauptungen“ geführt hatten (zit. n. Brünger, 2017, S. 183). Das Urteil vom 24. Februar 1972 bestätigte diese Einschätzung: Czichon wurden mehr als 30 Falschbehauptungen nachgewiesen, die in Zukunft zu unterlassen seien; als Schadenersatz wurde eine Summe von 20.000 Mark festgelegt (ebd., 2017, S. 191). Plötzlich in der Defensive, lotete Friedrich Karl Kaul die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Einigung mit der Bank aus – wohl auch, um einen möglichen Konkurs des Pahl-Rugenstein Verlags zu verhindern. Demnach verpflichtete sich die DDR, künftig alle direkten Angriffe auf Abs einzustellen; Czichon wurde zurückgepfiffen und die Restauflage seiner Bücher aufgekauft und eingestampft; im Gegenzug verzichtete Abs darauf, seinen Triumph öffentlich auszukosten und den Schadenersatz beizutreiben (ebd., S. 194).
Wissenschaft, Ideologie oder Kapitalismuskritik?
Besonders am Fall Hermann Josef Abs wir deutlich, dass die DDR den Kapitalismus als politisch-ideologischen Feind betrachtete. Dabei war die tatsächliche Entnazifizierung zweitrangig, vielmehr standen die eigenen politischen Vorteile und die Absicht im Vordergrund, die Eliten des „Klassenfeindes“ öffentlich vorzuführen. Um den Kapitalismus in seiner Gesamtheit zu schwächen scheute die SED-Diktatur auch nicht davor zurück, verzerrte Darstellungen für öffentliche Schauprozesse zu instrumentalisieren. Ironischerweise ging die Deutsche Bank aus dieser Auseinandersetzung sogar gestärkt hervor. Die Übertreibungen, Manipulationen und Lügen Czichons bewirkten genau das Gegenteil von dem, was ursprünglich beabsichtigt gewesen war: Die Kritik der DDR verpuffte im gesellschaftlichen Diskurs der Bundesrepublik, und auch die Glaubwürdigkeit der Geschichtsschreibung aus dem Osten war schwer beschädigt. Der Konflikt Abs vs. Czichon führte nicht zu einer Schwächung des Rheinischen Kapitalismus, sondern gerade zu einer Stärkung der westdeutschen Position in dieser politisch-ideologischen Systemauseinandersetzung.
Literatur
Arnold, Klaus (2002): Kalter Krieg im Äther. Der Deutschlandsender und die Westpropaganda der DDR, Münster/Hamburg/London.
Brünger, Sebastian (2017): Geschichte und Gewinn. Der Umgang deutscher Konzerne mit ihrer NS-Vergangenheit, Göttingen.
Czichon, Eberhard (1970): Der Bankier und die Macht. Hermann Josef Abs in der deutschen Politik, Köln.
Gall, Lothar (2004): Der Bankier Hermann Josef Abs. Eine Biographie, München.
Schanetzky, Tim (2004): Unternehmer: Profiteure des Unrechts, in: Frei, Norbert (2004), S. 69-116.
Wentker, Hermann (2023): Trials of Nazi Perpetrators in the GDR in the 1960s. How Important Was the Intra-German Context?, in: Steinbacher, Sybille (2023), S. 78-91.
Wixforth, Harald (2014): A Man for all seasons Revisited?. Anmerkungen zu Hermann Josef Abs und seiner Rolle während und nach der NS-Zeit, in: Osterloh, Jörg/Wixforth, Harald (2014), S. 299-327.